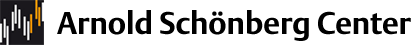Nr. 1: Präludium
Nr. 2: Gavotte – Nr. 3. Musette
Nr. 4: Intermezzo
Nr. 5: Menuett. Trio
Nr. 6: Gigue
AUFFÜHRUNGSDAUER: ca. 16 Min.
ENTSTEHUNGSZEIT: 1921-1923
ERSTAUFFÜHRUNG: 25. Februar 1924, Wien, Konzerthaus, Mozart-Saal (Eduard Steuermann)
ERSTDRUCK: Universal Edition, Wien (Juni) 1925 (UE Nr. 7627)
VERLAG:
Universal Edition
Belmont Music Publishers (USA, Kanada, Mexico)
Überblickt man Schönbergs Werkverzeichnis nach Opus-Zahlen, so scheinen die sieben Jahre nach 1912, dem Entstehungsjahr des epochalen »Pierrot lunaire« op. 21, eine Zeit geringer kompositorischer Produktivität gewesen zu sein. Tatsächlich vollendete Schönberg damals lediglich die Vier Orchesterlieder op. 22. Der Erste Weltkrieg mag äußerer Anlass für sein Schweigen gewesen sein, bei genauerem Hinsehen befand sich der Komponist allerdings eher in einer Phase des intensiven Suchens: er arbeitete an einem gigantischen Symphonieprojekt, verfasste den Text zur »Jakobsleiter« und komponierte den ersten Teil dieses umfangreich geplanten Chorwerks. Nach den in einem wahren Schaffensrausch entstandenen Opera 11 bis 21, die sich der Loslösung von der Dur/Moll-Tonalität anschlossen, strebte Schönberg nach einer Konsolidierung der neu gewonnenen musikalischen Kräfte. Bereits zu Beginn der »Jakobsleiter« deutet sich der eingeschlagene Weg mit einem thematisch-akkordischen Zwölftonkomplex an, hier jedoch – wie Schönberg selbst meint – noch als Einzelfall, nicht im Sinne einer methodischen Idee. »Danach beschäftigte mich ununterbrochen die Idee, der Struktur meiner Musik bewusst einen einheitlichen musikalischen Gedanken zugrunde zu legen, der nicht nur alle anderen Gedanken hervorbringen sollte, sondern auch deren Begleitung und die Akkorde, die ›Harmonien‹ regulierte.« (Brief an Nicolas Slonimsky, 3. Juni 1937). Als Schönberg diesem Ziel mit dem Jahr 1920 näher kam, gewann sein Schaffen neuen Antrieb, etwa zeitgleich entstanden bis 1923 die Fünf Klavierstücke op. 23, die Serenade op. 24 und die Suite für Klavier op. 25.
Wahrscheinlich handelte es sich um die erste Niederschrift des Präludium und Intermezzo aus der Suite op. 25 vom Sommer 1921, die Schönberg zu dem durch verschiedene Quellen überlieferten Diktum veranlasste, er habe »etwas gefunden, das der deutschen Musik die Vorherrschaft für die nächsten hundert Jahre sichere« (so bekannt geworden durch Schönbergs Schüler Josef Rufer). Bei aller Ironie, die in dieser Bemerkung mitschwingen mag, sollte Schönberg in gewisser Weise Recht behalten: Die »Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen« prägte in unterschiedlichen Varianten die Musik des 20. Jahrhunderts. Wesentlicher als alle hegemonialen Implikationen dürfte Schönberg jedoch die Bedeutung der Methode für sein eigenes Schaffen gewesen sein. Die Werke der folgenden Jahre zeigen abgesehen von ihrer ganz unterschiedlichen Wirkung das Bestreben, traditionelle Formen für die gewandelte, posttonale Musiksprache wieder zu gewinnen. So rekurriert die Suite op. 25 unmittelbar auf das Schaffen Johann Sebastian Bachs, mittelbar aber auch auf Mozart, die Musik des 19. Jahrhunderts, wie auch Schönbergs eigenen Versuch von 1897 (»Gavotte und Musette für Streichorchester«), die historisch gewordenen Satztypen mit neuem Inhalt zu füllen. Die der Suite zugrunde liegende Zwölftonreihe, deren Krebs übrigens mit den in der Musikgeschichte häufig verarbeiteten Tönen B-A-C-H beginnt, wird in dem Stück lediglich in 8 der 48 möglichen Derivate verarbeitet (jeweils Originalgestalt, Krebs, Umkehrung sowie Krebsumkehrung der Grundreihe und ihrer Tritonus-Transposition) – eine Beschränkung, die Schönberg durch eine flexible Handhabung der Technik, je nach Charakter der Einzelstücke, auszugleichen weiß.
Das Präludium, dessen erste Niederschrift vom 24. bis 29. Juli 1921 datiert, gewinnt seinen vorwärts drängenden Gestus neben dem Eröffnungsthema vor allem durch die im 3. Takt einsetzenden Tonrepetitionen. Lediglich in der Mitte des kurzen Stückes ergibt sich durch ein wiederholtes Seufzermotiv eine kurze Atempause. Die sich anschließende, graziöse Gavotte mit Musette bildet dazu einen nicht weniger lebendigen Gegensatz: Die tänzerischen Ursprünge der Satztypen lassen sich – erst recht im Vergleich mit den Suiten Bachs – deutlich heraushören, wenngleich die variantenreiche Rhythmik in Verbindung mit der synkopierten Begleitung eine klare Identifikation des Metrums beim ersten Hören erschwert. Das Intermezzo steht als langsamer Satz in der Mitte des Stücks, nach der Datierung auf den 25. Juli 1921 wurde es etwa zeitgleich zum Präludium begonnen. Während dort die Zwölftonreihe als polyphones Geflecht eigenständiger Stimmzüge entwickelt wurde, steht hier eine Begleitformel im Diskant einer ruhigen Melodie in tiefer Lage gegenüber. Was bei Betrachtung der Zwölftonregeln »verboten« erscheint – nämlich die Wiederholung eines Tons, bevor alle anderen erklungen sind – ist ein bei Schönberg häufig anzutreffender Vorgang, der sich aus der kompositorischen Situation ergibt. In seinen Zwölftonwerken gibt es kaum schematisch analysierbare Abläufe, stets jedoch bleibt die Logik einer auf der Reihe basierenden Struktur gewahrt. Hier wird aus den Tönen eines Reihenabschnitts ein sich wiederholendes Begleitmuster gewonnen, während die übrigen Töne das Thema formulieren. Auf dieser Basis entwickelt sich in ruhigem Tempo, wenngleich durch einige Ausbrüche unterbrochen, das weniger an die Epoche des Barock denn an die Klaviermusik des 19. Jahrhunderts gemahnende Stück. Es folgt ein Menuett mit Trio, wobei letzteres wohl zu den meistgedruckten Notenbeispielen aus Schönbergs Klavierwerk gehört: in harschem martellato werden sämtliche in der Suite auftretenden Reihenvarianten kanonisch miteinander verknüpft. Diese gewissermaßen schulbuchmäßig die Zwölftonmethode vorführende Episode dauert jedoch kaum mehr als eine Minute – umrahmt wird sie von dem zurückhaltenden, von einer gesanglichen Melodie geprägten Menuett, bei dem Schönberg den Reihenverlauf ausgesprochen frei gestaltet. Den Abschluss der Suite bildet eine mit kaum gebändigter rhythmischer Energie voranschreitende Gigue. Nach dem historischen Vorbild würde man hier einen 6/8-Takt erwarten, den Schönberg jedoch durch einen 2/2-Takt ersetzt, dessen metrische Struktur durch eine akribische Notation von Betonungszeichen sowie gelegentlich eingeschaltete 3/4-Takte variiert wird. Nicht auszuschließen, dass Schönberg Wolfgang Amadeus Mozarts Kleine Gigue in G-Dur KV 574 kannte, in der Abweichungen vom 6/8-Takt durch ähnliche Betonungsvarianten gestaltet sind. Zu diesem gleichermaßen von Innovationskraft wie tradierter Musikgeschichte geprägten Werk würde solch ein Vorbild zweifellos passen.
Eike Feß | © Arnold Schönberg Center