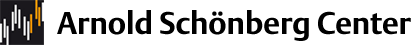Aus einem Briefwechsel mit Klaus Kropfinger
Kropfinger: Ist die von Boulez getroffene qualitative Unterscheidung von Schönbergs Kompositionen vor der Zwölftonperiode, also der »expressionistischen« Phase, und der Zwölftonperiode, da er unter anderem zu traditionellen Formen »zurückkehrte«, Ihrer Ansicht nach (noch) gerechtfertigt? »Qualitativ« meint hierbei sowohl Qualität im Sinne historischer Folgerichtigkeit (wie Boulez es sah/sieht) als auch, was die kompositionstechnische und ästhetische Qualität der Kompositionen selbst, ihre »innere« Stringenz angeht.
Ist es wirklich angemessen, Schönbergs Verwendung herkömmlicher Formen Sonate und Suite abwertend als »neoklassizistisch« zu bezeichnen? Hat er nicht vielmehr diese Formen – wenigstens partiell – gerade aufgrund der »Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen« in einen neuen kompositorischen Aggregatzustand versetzt?
Ist Schönberg für Sie als Komponist nach wie vor – und vielleicht gerade auch wegen seiner Zwölftonkompositionen, selbst da, wo er von überkommenen Formmodellen ausgeht – eine wichtige Orientierungsgröße?
Rihm: Die »Unterteilung« eines Gesamtwerkes ist mir grundsätzlich suspekt (siehe die irreführenden Reden vom »neuen Nono« etc.), denn es gibt selbst im Werk eines den Wandel thematisierenden Komponisten wie Strawinsky keine Note, die nicht gleichnah zur Mitte stünde. Ich habe allerdings persönliche Vorlieben, und eine solche Vorliebe gilt dem »Schönberg um 1910« – ich weiß aber wohl, daß ein Leben – und vor allem ein Mensch, der schöpferisch wirkt – nicht teilbar ist. Das aber mußte ich erst lernen. So kam ich mehr und mehr dazu, in Musiken, um die ich früher einen Bogen schlug (zum Beispiel das Bläserquintett, die Serenade, die Suite ...), jene Qualitäten aufzufinden, derer ich sie bar vermutete: plötzlich sprang mich die gleiche Hitze an, dieselbe Freiheit und Souveränität, fand ich die gleichen Knappheiten und Üppigkeiten, denselben Reichtum an Bezügen bei freiester Handhabung der Bezugsfelder, wie ich sie zu erkennen glaubte. Gleichzeitig war eine neue Dimension klanglicher Schärfe, ein ungeheuer schneidend-metallisches Espressivo hinzugekommen, das den durchaus erfahrbaren Wärme- (also auch Geschmeidigkeits-)Verlust als Erlebnis aufwiegen konnte. Die »Formzwänge« erscheinen mir zeittypisch und durchaus auch der Verunsicherung entstammend: Sicher wollte Schönberg teilhaben an einem internationalen Kunstdialog – und internationales Esperanto war damals der neoklassizistische Tonfall –, und er hatte wohl auch städtisches, weltstädtisches Fluidum in diesen Formzusammenstellungen, den gestückten, gegeneinander versetzten, zu bannen verstanden – die Fügungen, die in dieser Stilphase die Wuchsformen ablösen und die in der Panzerung von beziehungsweise durch » Unerbittlichkeit« und »Stringenz« sich durchaus als psychologische Panzerung lesen lassen dürften, diese gefügten (nicht mehr Organisches in erster Linie assoziierenden) Formteile waren damals sicher moderner, weniger jugendstilvergleichbar, mehr (und darin also auch auf Organisches bezogen) zellular, atomnäher, im Zeitton »wissenschaftlicher«, weniger » nur«-künstlerisch, »objektiver«. Das rückt sie uns ferner, und wir müssen den ersten Schritt tun: Die früheren Werke sind uns näher, wirken weniger »veraltet«, weil sie, als sie entstanden, aus Schönbergs innerem Monolog nach außen traten, unbezogen und fremd. Die späteren Werke (um die es Boulez geht) begegnen uns als »Ausdruck ihrer Zeit« – und sofort wirken sie schmaler, reduzierter, »weniger« als die un-zeitigen expressionistischen Stücke. So mag es sich »auch« verhalten; ob es auch so ist, weiß ich nicht. Was mir wichtig ist: Stringenz im ablesbaren Sinn besitzen sie fast mehr als die frühen Werke, fast könnte einer sagen: »Sie sind ›besser‹ komponiert.« Aber unvergleichlicher sind vielleicht doch die früheren. Inzwischen, wo ich die ungeliebten auch liebe, finde ich die Qualitäten der jeweils einen in den jeweils anderen.
Ich glaube, daß Schönberg die Formen benutzte wie einen Schreibgrund, auf den er schrieb. Ganz als Mittel, niemals als Zweck. Transportmittel vielleicht (dennoch: wie ich vorhin andeutete – der internationale Dialog, Paris, Kubismus, Picasso, Strawinsky – Berlin auch ...). Selbstverständlich wollte er nicht »die alten Formen « wiedereinführen; er trat ins Gespräch mit ihnen, intimer vielleicht als Strawinsky, der sie »nur« montierte, der sich eigentlich nicht mit ihnen unterhielt. Außerdem, so wie die Texte in der expressionistischen Phase oft als schlichte Garanten überhaupt irgendeines Ablaufs fungierten, so dürften die alten Formen (als »Texte von Musik«) in der »Zwölfton-Phase« als Garanten des Fortkommens und zwar: des Fortkommens der kombinatorischen Felder fungiert haben. Die kombinatorischen Potenzen mußten ja bewegt werden, sie ergaben sich nicht von selbst als energetischer Fluß (und hier sitzt mein Kritikpunkt an dieser – wie an jeder – Systembildung: ihre Unterbrechung des Fließens, der Gestaltkonfiguration aus sich selbst heraus, selbst und gerade wenn das System aus diesem Grund entwickelt wurde, die Gestaltkonfiguration zu garantieren), diese kombinatorischen Figur-Felder tendieren nach meinem Gefühl zur Statik, zur, heute würden wir sagen: »minimalistischen« Konfiguration. […] Die Formen, denen Schönberg den Ablauf, den gerichteten Ablauf, überantwortete, sind ja in erster Linie keine dynamischen Prozesse, sondern ihrerseits »stehende Bilder«, solche des gleichbleibenden Ablaufmodus, des durchgehaltenen Charakters. Eher weniger rekurriert er auf die Sonate, und auch dort empfinde ich eine Abkehr von dualistisch-dialektischen Gestalten und Gestaltfeldern zugunsten einheitlich charakterisierter, nahtlos gefugter Mauerung (unvergleichlich im Dritten Streichquartett, das ich lange nicht verstand, nicht verstehen wollte; ich haßte die albertibaßhaften Begleitfiguren des Beginns in meiner Jugend besonders vor dem Hintergrund von Schönbergs Hauff-Verweis – heute sehe ich das etwas differenzierter, erlaube mir sogar, in den zwanghaften Abläufen eben jene Nagelung zu erkennen, die den Kapitän – = Schönberg? – an den Mast bohrt und am eigentlichen Steuern hindert). Nun, Schönberg ist aber nicht Hauer, und deswegen ist »Zwang« bei ihm immer etwas Heißes, Lebendiges, Erotisches (wenn auch manchmal spürbar unausgelebt), jedenfalls nichts, was nur auf dem Papier tropisch sich verhält.
Schönberg ist für mich als Gesamterscheinung, unretuschiert als widersprüchlichster Geist und generativer Mensch von ungeheurer Energie, weiterhin die Batterie, die Ladung, an der Aufladung zum Gebot wird. (Webern und Berg erfahre ich – bei aller Liebe – als sehr von dieser Aufladung Abhängige.) Schönberg bleibt die Primärquelle. Bei ihm rundet sich nichts zum klassischen Modell, und wenn er von »System« spricht, hört es sich an, als referiere er ein Gegenteil. Bei ihm ist Dichte nichts Erstelltes, sondern das Mal des Gesagten, des Komponierten. Und wenn er in biographischen Phasen anderen Ausdruck suchte und fand und verfehlte und wiederfand, so ist er als schöpferische Potenz ungleich weitreichender als einer, der den Ausbau von Errungenschaften betriebe. Schönberg ist Verschwender, ein Über-Reicher. In seinem Bann zu sein bedeutet aber nicht zu erstarren, sondern vielmehr: in Bewegung zu geraten und auch zu bleiben, un-ent-wegt.
Ich gehe jetzt ins Orchesterkonzert, um jene Figuren, Doppel und Prismen von Boulez zu hören, in denen Schönberg alles andere als »mort« ist... Gerade da lebt er auf, falls er je tot war. Ich glaube auch, daß jeder Künstler, wenn er stirbt, erst einmal auf eine produktive Weise tot ist. Seine Gebote (ob von ihm errichtete oder von Exegeten ergangene) sterben sofort ab; alles, was auf Ausbau, auf Existenzsicherung, gar auf Nachleben hin entworfen sein mag und was eh nur dazu dient, schwächeren Positionen ein unverdientes Regendach zu gewähren, all das Sekundäre ist nach dem Tod dessen, um den es aufgerichtet ward, sofort der stärksten Erosion ausgesetzt. Und das ist gut so, denn so wird die primäre Erscheinung, die Substanz, das Wesentliche, unverstellt sichtbar und mit der Zeit erkennbar als »unsterblich«. Das Gegeneinander-ausgespielt-Werden ist der Preis der Zeitgenossenschaft. Heute leben Schönberg und Strawinsky. Mozart wird zwar gerade wieder einmal ermordet, aber keine Sorge: in einem Jahr setzt er sich wieder zu Strawinsky und Schönberg, die ihn freudig begrüßen und ihn fragen, wo er denn die ganze Zeit gesteckt habe […].
(1991)
Ausgesprochen. Schriften und Gespräche. Band I. Herausgegeben von Ulrich Mosch. Winterthur 1997 (Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung. 6/1.), p. 273–275
Wolfgang Rihm: Arnold Schönberg
- Details