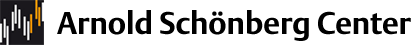Respekt vor seiner Musik hat sich Schönberg für uns heute vor allem durch seine frühen Ausbrüche aus dem Tonalen, von der Kammersymphonie op. 9 bis zur Erwartung und zum Pierrot lunaire gesichert: durch die Werke also, welche ursprünglich neben Wut und Aufregung vor allem eine besondere Art Angst hervorgerufen haben, Angst vor einer Rücksichtslosigkeit, die vor keiner Tabu-Verletzung zurückzuschrecken schien. Gegenüber dem Zwölfton-Schaffen hingegen weiß sich solch emotionales Verhalten fehl am Platz. An seine Stelle ist heute eine besondere Art Verlegenheit getreten, Produkt jenes typischen Mißverständnisses, welches in der Kunst keine unaufgelösten Widersprüche duldet, sie notfalls ignorieren möchte, und sich an das klammert, was als mit sich selbst Identisches zur Identifikation einlädt, und sei es als Neo- oder Anti-Kunst.
Die Musik Strawinskys entsprach in ihrer Oberfläche solchen Erwartungen, auf andere Weise auch diejenige Hindemiths und Bartóks, selbst das Schaffen Bergs und Weberns fand in diesem Sinn vorläufige Wege der Vermittlung, von den akustischen Dekors einer etablierten Avantgarde ganz zu schweigen.
Die Zwölftonmusik Schönbergs klingt wie Erbrochenes für diejenigen, welche Stimmigkeit des Materials in ein neues Musikdenken hinüberretten wollen. Sie vollzieht mit gebrochenem Rückgrat altgediente philharmonische Rituale und provoziert so im Hörer ästhetische Schizophrenie. Traditionelle Formen, tonal orientierte Gestik, musikantische Emphase, durch Zwölfton-Regeln verspannt und entkräftet: »Hier kann man sie noch erblicken, feingeschrotet und in Stücken«. Gerade als so verkrüppelte und entstellte lädt diese Musik immer noch zur Verbrüderung ein. Solche Provokation, das Ernsteste und Zynischste seit der Achten Mahlers, ist nicht erträglich. Die Gesellschaft, außerstande, dieser trostlosen Musik und ihrem Wahrheitsanspruch standzuhalten, hat schon ihre Techniken, sich ihr zu entziehen: Wahrheit langweilt, damit sie nicht beunruhigt. Kunst für unsere Gesellschaft ist Medium von Identifikation. Widersprüche sollen nicht begriffen, sondern rezensiert werden.
Man hat im ästhetischen Bereich das Umdenken lange genug versucht, und zwar vergeblich, und man zieht nun das alte beliebte Spiel der Selbstbestätigung durch Kunst an neuem Material auf. Musik möchte ihre ursprünglichen bürgerlich-idealistischen Positionen vergessen. In Schönbergs Musik aber bleibt die Forderung nach Schönheit, Größe und Wahrheit gerade als gescheiterte peinlich fratzenhaft bestehen. Das Ausweichen des Musikdenkens heute vor solchen Kriterien, die Flucht der Gesellschaft vor dieser Fratze, in welcher sie sich wiedererkennt, ist dabei, sich zu rächen. Der ästhetische Genuß, in einer pluralistischen Gesellschaft von seinen historischen Auflagen scheinbar entlastet und aus sich selbst heraus neu bestimmt, profitiert zunächst noch von dem Moment des Antithetischen, dann aber löst er sich, nutzlos, überflüssig, in nichts auf. Geist, als virtuose Anlage des menschlichen Bewußtseins, muß sich, um nicht geistlos zu werden, eben doch in die Gefahr gesellschaftlicher Verbindlichkeiten begeben. Die Stagnation des Komponierens heute ist die Folge einer geistigen Atropie durch bequemes Verharren in ästhetizistischen Scheinproblemen und durch Ausweichen in vordergründige Scheinkonflikte. Für ein Gesellschaftsbewußtsein, welches so mit dem alten Kunstbegriff jongliert, um zu vertuschen, daß er ihm im Grunde überflüssig geworden ist, ist Schönberg tot.
Tote aber leben länger. Das Angebot der Musik Schönbergs, ihre aktuelle Neubestimmung des Schönheitsbegriffs, liegt genau dort, wo die Kunst nochmals ihren bürgerlichen Wahrheitsanspruch beim Wort nimmt. Von der Faszination des erkalteten und erkaltenden tonalen Materials bleibt dabei nichts übrig als zum Selbstzweck geronnene satztechnische Anstrengung. Phantasie, Vitalität, Expressivität, Mut zum Schockierenden: Schönberg hat das einst mehr bewiesen als alle anderen. Sie waren ihm nie Tugenden um ihrer selbst willen. So hat er sie nun rücksichtslos temperiert und entschärft. Neuen Kategorien des Materials hat er zugleich den Zutritt verstellt. Die Klangfarbenmelodie blieb ein futuristisches Gedankenspiel, nichts weiter.
Jene verabsolutierte satztechnische Anstrengung aber bedeutet mehr, als zum Manierismus erstarrte zwölftönige Frustration. Sie weiß um ihren Widerspruch und fordert eine charakterliche Anstrengung des Hörens: nicht masochistische Toleranz oder gescheites Stirnrunzeln, sondern das reflektierte Ausharren im Widerspruch.
Denn gerade auf diesen ausgehaltenen Widerspruch gründet sich, sozusagen als dessen Kehrseite, ein Erlebnis totaler Durchsichtigkeit des klingenden Stoffs, wie es nirgends als nur im Zwölftonwerk Schönbergs möglich ist. Strukturelle Transparenz war ein altes unerreichbares, weil widersprüchliches, Ziel der Komponisten. In der Polyphonie Bachs noch am ehesten erfahrbar, war sie auch dort gefährdet durch die vertikale Integration in die Formeln der Generalbaß-Harmonik, die für öffentliche Ordnung und harmonische Stimmigkeit sorgte. Solche tonale Ordnung kündigt Schönberg, ohne ihre Elemente zu verleugnen, mit jedem einzelnen Ton von neuem auf. Das expressive Resultat ist Trostlosigkeit, das strukturelle Resultat ist verdächtig klare Durchhörbarkeit eines sonst in harmonisch gewärmter Schummrigkeit vertrauten Satzgefüges: ein Material, wohlbekannt und fremd zugleich: der Leichnam der Trösterin Musica als Aufforderung, erwachsen zu werden, los zu kommen von Trost. Trostlose Musik als Absage an Wehleidigkeit. Musik als Abbild dessen was ist, durch Scheitern an dem, was sein soll: Das ist der dialektische Realismus, in welchem Schönberg sie uns vorstellt.
Mehr als dem Hörer kann Schönberg auch dem Komponisten von heute nicht bedeuten. Was soll man noch von ihm lernen?
Was er an Material und Methode erschlossen hat, hat er zugleich wieder verschlossen; es bleibt stilistisch und expressiv an sein Idiom gebunden. Die Komplexität seiner Kompositionstechnik ist in ihrer Manieriertheit zugleich ihre Armut. Daran sich anlehnen, wie er selbst es an Brahms, Mozart, Bach und Beethoven tat, könnte nur sinnentleerte Verdinglichung bedeuten. Neuen ästhetischen Welten, zu deren Erschließung er moralische Kräfte allenthalben bei Schülern und Zeitgenossen mobilisiert hat, gehört seine Musik nicht an. So hat er für Komponisten augenscheinlich die Aktualität und Patina eines Klassikers. Von Klassikern zu lernen, ist ohnehin eine Kunst für sich. Leichter ist es, sie als Tote zurecht zu verehren, als in sich vollendete und für uns ungenügende Erscheinungen. Bei Schönberg allerdings bleibt auch dann noch ein Widerhaken, der uns wurmt: Ein Kriterium des Scheiterns, um das wir ihn bemitleiden, oder ihn beneiden.
Beitrag für den Südwestfunk Baden-Baden zum 100. Geburtstag Schönbergs, gesendet am 13. September 1974; veröffentlicht in: Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966–1995. Wiesbaden etc. 2004, p. 261-262
Helmut Lachenmann: Über Schönberg
- Details