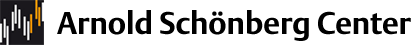Er zählt zu den umstrittensten Persönlichkeiten der Wiener Musikwelt. Die einen schätzen ihn als ernsten, gediegenen Musiker von Bedeutung, die anderen begegnen ihm mit brüsker Ablehnung, zuweilen selbst mit Spott und Hohn. So hat erst vor kurzem die Aufführung eines Schönbergschen Kammermusikstückes im Quartett Rosé einen im Konzertsaal wohl seltenen Skandal hervorgerufen. Zu kritischer Stellungnahme für oder gegen das Werk selbst ist hier nicht der Platz, sie sei gern berufeneren Feder überlassen. Die eigenartige und interessante Persönlichkeit des Komponisten aber wird vielleicht manches zum Verständnis seines künstlerischen Wesens und seiner Art beitragen.
Schönberg ist immer in gewissem Sinne ein Einsamer, abseits vom breiten Wege Schreitender gewesen. Er war immer ein Suchender, neuen Werten Nachspürender. Ich erinnere mich mancher Gespräche, die ich mit Arnold Schönberg führte – vor langer Zeit –, es mögen an siebzehn Jahre sein, da wir beide einem kleinen Freundeskreis von strebenden, jungen Leuten angehörten, die ihre ersten künstlerischen Versuche anstellten. Auch Leo Fall und Edmund Eysler zählten zu diesem Kreise. Beide haben sich der heiteren Muse zugewendet und große, auch materielle Erfolge erzielt. Schönberg, schon damals zum Grübeln neigend, hat sich immer tiefer in den Ernst der Kunst eingegraben, der materiell freilich nicht auf Rosen bettet, und heute trennen die einstigen Jugendfreunde Abgründe der künstlerischen Anschauungen.
Ich suche Schönberg in seinem Heim in der Liechtensteinstraße auf. Freundliche Räume, von schlichter, durch Geschmack verschönter Einfachheit. Ein paar Bilder, die die Wände zieren, verraten mir, daß der Künstler auch den Pinsel führt. Und zwar mit einer merkwürdigen Begabung, in einer breiten, impressionistischen Manier, mit starker Wirkung der Fläche. Ein kleiner Kopf, der interessante Versuch eines Selbstporträts fällt mir auf durch die Kunst, mit der Schönberg den eigentümlich milden und doch zuweilen flackernden Blick seines Auges festzuhalten vermochte. In einer Ecke ist eine charakteristisch erfaßte Büste Schönbergs von der Meisterhand Josef Heus. Ueber seinem Schreibtisch hängen zwei Bilder mit herzlichen Widmungen Gustav Mahlers, und ein Porträt Zemlinskys grüßt von der Wand des Mittelpfeilers. Das ist der schlichte, unaufdringliche Schmuck seiner Räume, seiner kleinen, aber mit feiner Empfindung tief erfaßten Welt. Seine Art ist schlicht und anspruchslos, aber voll Nachdruck und Energie in jeder künstlerischen Aeußerung. Er geht während des Gesprächs nervös im Zimmer auf und ab. In dem rundlichen, bartlosen Gesicht, das sonst einen merkwürdig stillen, fast pastorenhaften Ausdruck hat, beginnt es zu arbeiten. Ein leichtes Stirnrunzeln, ein Aufflackern des Auges verrät die Tätigkeit seiner Gedanken. Er strebt mit redlichem Bewusstsein. Erfolg und Mißererfolg beirren ihn nicht. Er stellt keine großen Anforderungen an das Leben. Das macht ihn innerlich unabhängig, macht ihn mutig. Er kennt keine Konzessionen an den Geschmack der Menge. Er geht seinen Weg, wie seine innere Entwicklung ihm denselben vorschreibt, unbekümmert ob ihm die Sonne des Erfolges lacht, oder ihn die Stürme des Widerspruchs umbrausen. Er blickt aus seiner künstlerischen Innenwelt, wie durch Fensterscheiben geschützt, hinaus auf das Getriebe. Die Zeit beirrt ihn nicht, aber – man merkt es an der Entschiedenheit, mit der er seine Urteile prägt – sie läßt ihn doch nicht ohne Bitterkeit. Aber er trägt sie mit völliger Resignation, wie eine unausweichliche Selbstverständlichkeit. Mag er irren oder nicht, in der Festigkeit seiner künstlerischen Zuversicht liegt etwas Rührendes und Achtunggebietendes.
Ich frage nach entscheidenden Faktoren seiner künstlerischen Entwicklung, und Schönberg meint:
»Der bestimmendste Faktor sind wohl die inneren Notwendigkeiten der eigenen Entwicklung. Man entwickelt sich nicht absichtlich und bewußt. Die musikalische Umwelt übt zweifellos gewisse Einflüsse aus. Erst wurde ich Wagnerianer – dann kam die weitere Entwicklung ziemlich rasch.
Es gehen heute alle künstlerischen Evolutionen in sehr rascher Folge vor sich. Ich könnte meine Entwicklung sehr genau analysieren, nicht theoretisch, aber retrospektiv. Es ist eine interessante Beobachtung, daß dasjenige, das den Anstoß zur Entwicklung gegeben hat, meist sein eigenes Gegenteil hervorruft, daß es, sobald man es verdaut hat, auch das erste ist, das uns wieder abstößt, so daß die Entwicklung immer eine Reaktion gegen das bedeutet, was sie hervorgerufen hat ... Und ich glaube, wenn ich meine Entwicklung ins Auge fasse, daß ich eigentlich damit die Entwicklung der letzten zehn bis zwölf Jahre Musik beschreibe – es fällt da in mir vieles zusammen mit Reger, Strauß, Mahler, Debussy und andern.«
Ich spreche von dem Einfluß Wagners auf die Entwicklung der modernen Musik, und Schönberg antwortet:
»Wagner hat uns drei Sachen – der Hauptsache nach, soweit er für die moderne Entwicklung in Betracht kommt – hinterlassen: Erstens die reiche Harmonik, zweitens die kurzen Motive, mit ihrer Möglichkeit, den Satz so rasch und so oft zu wenden, als es das kleinste Stimmungsdetail erfordert, und drittens gleichzeitig die Kunst, großangelegte Sätze zu bauen, und die Perspektive, diese Kunst weiter zu entwickeln. – Alles das scheint sich der Reihe nach entwickelt zu haben, um dann in das Gegenteil umzuschlagen. Das erste, das zu gären angefangen hat, scheint die Harmonie des Ausdrucks gewesen zu sein. Dabei haben die kurzen Motive wohl zunächst zu einer Versinnbildlichung der Technik geführt. Die meist sequenzierende Fortführung hat einen Ausfall an Formfeinheiten zur Folge gehabt. Die erste Reaktion darauf ist das Ueberwuchern der Formen und das Suchen nach den langen Melodien, wie beispielsweise bei Richard Strauß im Heldenleben...«
Ich frage Schönberg: »Halten Sie die Melodie in dem Sinne, wie sie gewöhnlich verstanden wird, für überwunden?«
»Wenn man meine letzten Sachen ansieht, könnte man die Antwort finden. Sie sind noch durchaus melodisch. Ich glaube nur, daß die Melodie andere Formen annimmt. Ueberdies glaube ich, daß man sich über den Begriff Melodie nicht im klaren ist. Gewöhnlich versteht man unter Melodie – das, was man nachpfeifen kann. Aber was ein Musiker und was ein Nichtmusiker nachpfeifen kann, ist schon sehr verschieden. Im allgemeinen scheint man unter Melodie eine möglichst prägnante Formung eines musikalischen Gedankens von lyrischem Charakter, mit möglichst übersichtlicher Anordnung zu verstehen. Bei der Einfachheit aber, die an der Melodie besticht, ist die Kehrseite der Medaille: die Primitivität. Es ergibt sich von selbst, daß unsere Einfachheit eben anderer Art ist als die unserer Vorgänger, daß sie komplizierter ist und daß eben diese Kompliziertheit eines Tages wieder als primitiv empfunden werden wird.«
»Glauben Sie, daß die Menge diesen Formen der Entwicklung Verständnis entgegenbringt?«
»Es ist nicht verwunderlich, daß eine Zeit gerade die vorhergehende Entwicklungsstufe nicht begreift oder goutiert, da sie die Reaktion ist. So war es gewiß kein Zufall, daß vor zehn Jahren die Wagnerianer begonnen haben, Mozart und Beethoven zu entdecken. Aber nicht diese haben sie entdeckt, sondern den Wagner haben sie verloren. Es findet eben nach meinem Gefühl in der Entwicklung eine ähnliche Erscheinung statt wie in der Medizin bei der Vererbung. Nur im umgekehrten Sinne. Die Reaktion pflegt beim Zurückgreifen auch gewöhnlich das nächstliegende Glied der Entwicklungskette zu überspringen.«
»Glauben Sie, daß das Publikum dieser Entwicklung zu folgen vermag? Ich denke, daß die breite Menge doch immer bei gewissen musikalischen Formen verharren wird.«
»Ich glaube, daß das Niveau der Durchschnittsbildung sich wird wesentlich heben müssen, oder daß die Kunst wieder das werden wird, was sie früher einmal war, eine Angelegenheit einer Auslese der kultiviertesten Menschen der Zeit. Ich erhoffe aber, aufrichtig gestanden, das Gegenteil.«
Meine Frage geht nun dahin, ob der Geschmack des Publikums den Künstler beeinflusse, und Schönberg entgegnet:
»Nein! Den wirklichen Künstler niemals, denn dieser ist nicht in der Lage etwas anderes zu schaffen als das, wozu ihn seine Natur und Entwicklung drängen. Leider glaubt mancher hie und da sich nach dem Publikum richten zu können, und der momentane Erfolg lohnt es auch, aber der Verrat rächt sich unbedingt später. Denn wer nicht auf irgendeine Art die Natur des Publikums in sich trägt, der wird es nicht treffen, ihm so ganz zu gefallen. Man merkt bald das Unechte, und der Verrat ist meistens zwecklos.«
Wir kommen auf die Stellung des Künstlers zum Publikum zu sprechen, und ich frage Schönberg, ob der Erfolg oder Mißerfolg sein Selbstgefühl hebe oder seine Zweifel vertiefe, und er antwortet mir mit einem ironischen Lächeln: »Publikum und Kritik sind heutzutage so sehr von allen guten Geistern der Kunst verlassen, daß sie in keiner Hinsicht mehr einen Maßstab abgeben können. Man kann heute nicht einmal mehr durch einen Mißerfolg Selbstvertrauen zu sich bekommen. Das Publikum und die Kritik erkennen nicht einmal mehr ihren eigenen Geschmack in der künstlerischen Einkleidung, so daß sie zuweilen selbst Werken Mißerfolge bereiten, die ihnen eigentlich zusagen müßten. Sie erkennen ihres eigenen Geistes Kinder nicht mehr.«
Ueber die Wiener Kritik speziell äußert sich Schönberg mit herber Ablehnung, aus der man den starken Grad seiner Verbitterung, aber auch seiner tiefen inneren Vereinsamung heraushört. Und er schlägt dabei wohl leidenschaftlich übers Ziel. Aber der redliche Mut, mit dem er seine Überzeugung ausspricht, hat etwas Sympathisches an sich. Auf meine Frage: »Glauben Sie, daß sich in unserer Zeit ein Künstler auch gegen die Meinung der Kritik und des Publikums durchzusetzen vermag?« erwidert er: »Das werde ich erst am Ende meiner Tage zu beurteilen vermögen.«
Mit dieser stolzen Antwort schließt unsere Unterhaltung, denn die Zeit ist vorgeschritten. Ein Schüler wartet und die Pflicht ruft. Ich verabschiede mich herzlich von dem Künstler, von dem ich das Gefühl habe, daß er zu jenen wenigen gehört, die sich durch den Ernst und die Unerschütterlichkeit ihres künstlerischen Glaubens selbst zur freiwilligen Einsamkeit verurteilen.
Neues Wiener Journal (10. Januar 1909)